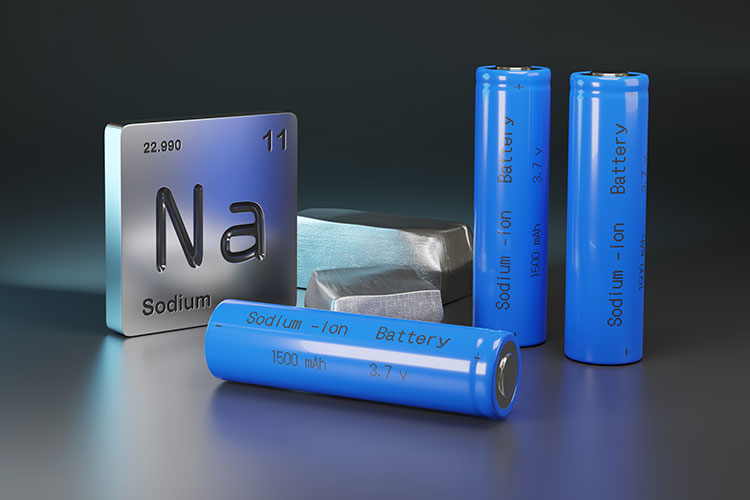 Natrium-Ionen-Batterien gelten zwar als umweltfreundlich, aber auch als leistungsschwach. Doch das könnte sich durch gezielte Materialoptimierung ändern. © Freepik/juanroballo
Natrium-Ionen-Batterien gelten zwar als umweltfreundlich, aber auch als leistungsschwach. Doch das könnte sich durch gezielte Materialoptimierung ändern. © Freepik/juanroballo
Strom macht glücklich. Wenn man rechtzeitig drauf schaut, dass man ihn hat, wenn man ihn braucht. Genau hier kommen neue Technologien wie Natrium-Ionen- oder Magnesium-Batterien ins Spiel.
Energieerzeugung ist nur die eine Seite der Medaille. Damit die Energiewende gelingen kann, muss nachhaltig erzeugter Strom auch gespeichert werden können. Die heute dafür verfügbaren (Akku-)Technologien, wie Lithium-Ionen-Batterien, sind mit gewissen Nachteilen verbunden, angefangen bei der Notwendigkeit verschiedener mehr oder weniger seltener, aus verschiedenen Gründen kritischer Rohstoffe. Die Stichworte in diesem Zusammenhang lauten etwa begrenzte Verfügbarkeit, geopolitische Abhängigkeiten oder unzureichende Recyclingprozesse. Doch es wird intensiv an Alternativen – sogenannten Post-Lithium-Technologien – geforscht.
Eine davon sind Natrium-Ionen-Batterien. Sie gelten als umweltfreundlich, jedoch häufig auch als leistungsschwach. Eine aktuelle Studie der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB und der Universität Münster („Benchmarking state-of-the-art sodium-ion battery cells – modeling energy density and carbon footprint at the gigafactory-scale“) stellt jedoch fest, dass sie an der Schwelle zur industriellen Massenproduktion stehen. Besonders für Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Energiedichte bieten sie bereits heute eine tragfähige und nachhaltige Alternative. Erwartete Materialoptimierungen könnten dazu führen, dass Natrium-Ionen-Batterien in den kommenden Jahren auch in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.
Laut Studienautor Philipp Voß, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fraunhofer FFB, ist die Technologie vielfältiger als bislang angenommen. „Je nach Zellchemie unterscheiden sich die Energiedichte und die Klimabilanz zum Teil erheblich“, erklärt Voß. Die Studie belegt erstmals diese Differenzierung durch eine umfassende Modellierung auf Basis industrieller Produktionsdaten im Maßstab von Gigafabriken mit Fokus auf die Energiedichte und den CO₂-Fußabdruck.
Natrium-Ionen-Batterien auf dem Weg in den Massenmarkt
Batterietechnologien der nächsten Generation spielen eine Schlüsselrolle für die Energie- und Mobilitätswende. Gerade Natrium-Ionen-Batterien gelten als vielversprechende Alternative zu Lithium-Ionen-Technologien, vor allem aufgrund besserer Verfügbarkeit der Rohstoffe und potenziell geringerer Umweltwirkungen. In der Studie wurden ausschließlich Zellchemien und Materialien untersucht, die gegenwärtig von kommerziellen Herstellern verfolgt und weiterentwickelt werden.
Die Studienergebnisse zeigen: Aktuell speichern Natrium-Ionen-Batterien noch weniger Energie als Lithium-Ionen-Batterien auf Basis von Lithium-Eisenphosphat, insbesondere bezogen auf das Volumen. Den Studienautoren zufolge lässt sich dieser Rückstand durch gezielte Materialoptimierung reduzieren und bei einzelnen Zellchemien sogar vollständig ausgleichen. „Zellen mit Schichtoxid-Kathoden zählen zu den vielversprechendsten Kandidaten unter den Natrium-Ionen-Batterien. Sie erzielen die höchsten Energiedichten unter den untersuchten Zelltypen“, erklärt Voß.
Auch beim CO₂-Fußabdruck schneiden viele Natrium-Ionen-Zellchemien laut Studie bereits gut ab. Besonders die Verwendung von Hartkohlenstoff („Hard Carbon“) als Anodenmaterial zeige Vorteile. Im Vergleich zum in Lithium-Ionen-Batterien verwendeten synthetischen Graphit, dessen Herstellung besonders energieintensiv ist, lässt sich Hard Carbon deutlich klimafreundlicher produzieren. „Der geringe Energieverbrauch bei der Herstellung von Hard Carbon senkt nicht nur die Emissionen, sondern auch die Kosten für das Anodenmaterial – ein entscheidender Vorteil gegenüber der Lithium-Ionen-Technologie“, erläutert FFB-Institutsleiter Simon Lux.
Schon jetzt drängen Natrium-Ionen-Batterien auf den Batteriemarkt, und mehrere Unternehmen verfolgen Pläne für eine Produktion im Gigafactory-Maßstab. Die Drop-in-Technologie für bestehende Fertigungslinien für Lithium-Ionen-Batterien senkt die Markteintrittsbarrieren erheblich und beschleunigt die Produktionssteigerung. „Mit Natrium-Ionen-Batterien haben wir die Chance, uns geostrategisch unabhängig von Ländern wie China zu machen“, betont Lux. „Um dieses Potenzial zu heben, ist eine gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien unerlässlich.“
Von Lithium zu Magnesium
Ein anderer erfolgversprechender Kandidat, um Lithium zu ersetzen, ist Magnesium. Es ist in der Erdkruste etwa 1.000-mal häufiger als Lithium, sicherer in der Handhabung, kostengünstig und besitzt ein hohes theoretisches Speicherkapazitätspotenzial. In dem EU-geförderten Forschungsprojekt „HighMag“ („High-energy, low-cost and scalable generation 5 magnesium-based batteries for mobility applications and beyond“) unter Leitung des AIT Austrian Institute of Technology wird an der Entwicklung einer neuen Generation von Batterien auf Magnesium-Basis gearbeitet.
Dabei werden zwei Batteriearchitekturen parallel weiterentwickelt: zum einen Magnesium-Schwefel-Systeme mit Konversionskathoden, zum anderen Magnesium-Metall-Systeme mit Insertionskathoden. Dazu wird ein neuartiger, beschichteter Mg-Anodenwerkstoff in Pulverform entwickelt, der für beide Systeme geeignet ist. „HighMag“ adressiert die zentrale Herausforderung von Magnesium-Batterien: die bislang geringe elektrochemische Aktivität und Stabilität in wiederaufladbaren Systemen.
Als Koordinator übernimmt das AIT Austrian Institute of Technology nicht nur die Gesamtsteuerung, sondern auch Schlüsselaufgaben in der direkten Forschung und Entwicklung. Projektleiter Yuri Surace, Senior Scientist am AIT, unterstreicht die Bedeutung: „Magnesium steht an der Spitze der nächsten Batteriegeneration. Mit ‚HighMag‘ entwickeln wir nachhaltige, leistungsstarke und kostengünstige Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien. Unser Ziel ist es, die Technologie vom Labor bis zur Pilotproduktion voranzubringen – ein wichtiger Schritt für sichere und ressourcenschonende Energiespeicherlösungen, die Mobilität und Energiewende nachhaltig prägen werden.“
Auch Andreas Kugi, Scientific Director des AIT, unterstreicht: „‚HighMag‘ ist ein Leuchtturmprojekt der europäischen Batterieforschung. Mit der Entwicklung von Magnesium-Batterien von der Grundlagenforschung bis hin zur industriellen Machbarkeit stärken wir Europas technologische Souveränität und schaffen die Basis für eine nachhaltige und resiliente Energiezukunft.“
Ein zentrales Leitprinzip von „HighMag“ ist Safe-and-Sustainable-by-Design. Von der Materialentwicklung bis zum Recycling werden Umwelt- und Sicherheitsaspekte integriert. Parallel dazu legt das Projekt großen Wert auf industrielle Umsetzbarkeit: Die Technologien werden so entwickelt, dass sie mit bestehenden Produktionslinien für Lithium-Ionen-Batterien kompatibel sind. Damit schafft „HighMag“ die Voraussetzungen für eine rasche Skalierung und eine strategische Stärkung der europäischen Batterieindustrie. (RNF)